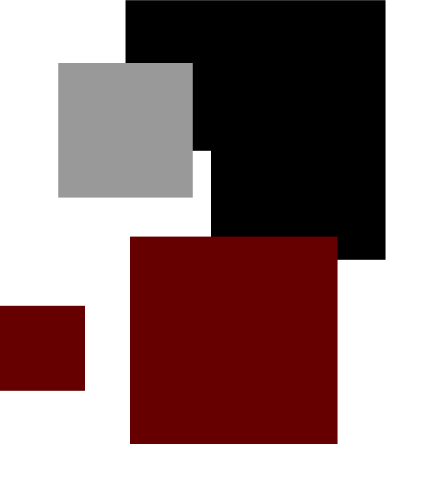

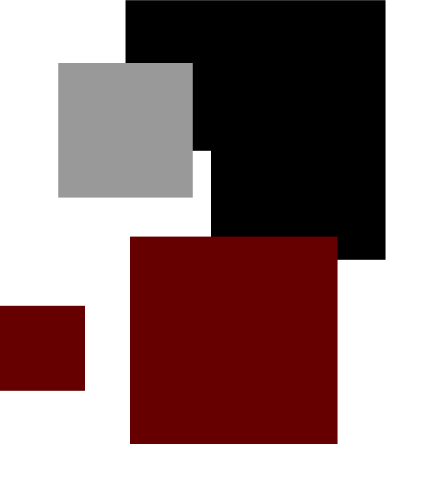

Fehler 404
Seite nicht gefunden
Die angeforderte Seite konnte nicht gefunden werden.
Bitte versuchen Sie es erneut über unsere Startseite.
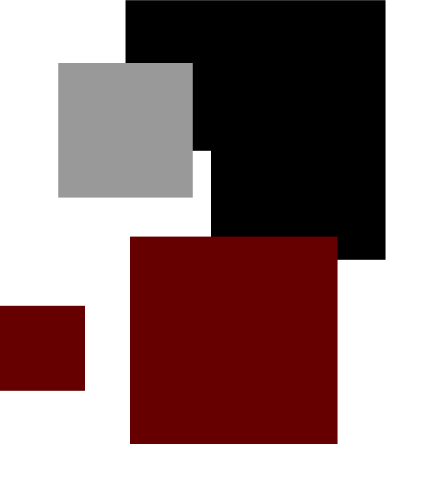

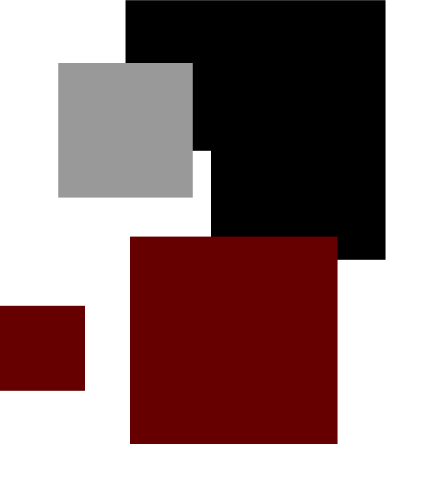

Die angeforderte Seite konnte nicht gefunden werden.
Bitte versuchen Sie es erneut über unsere Startseite.